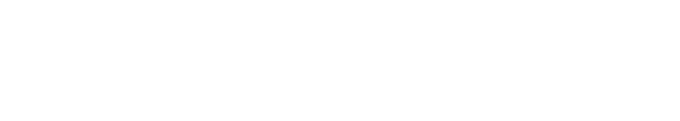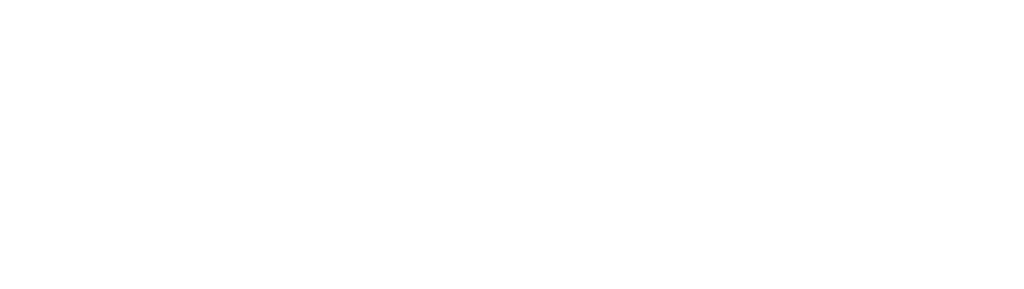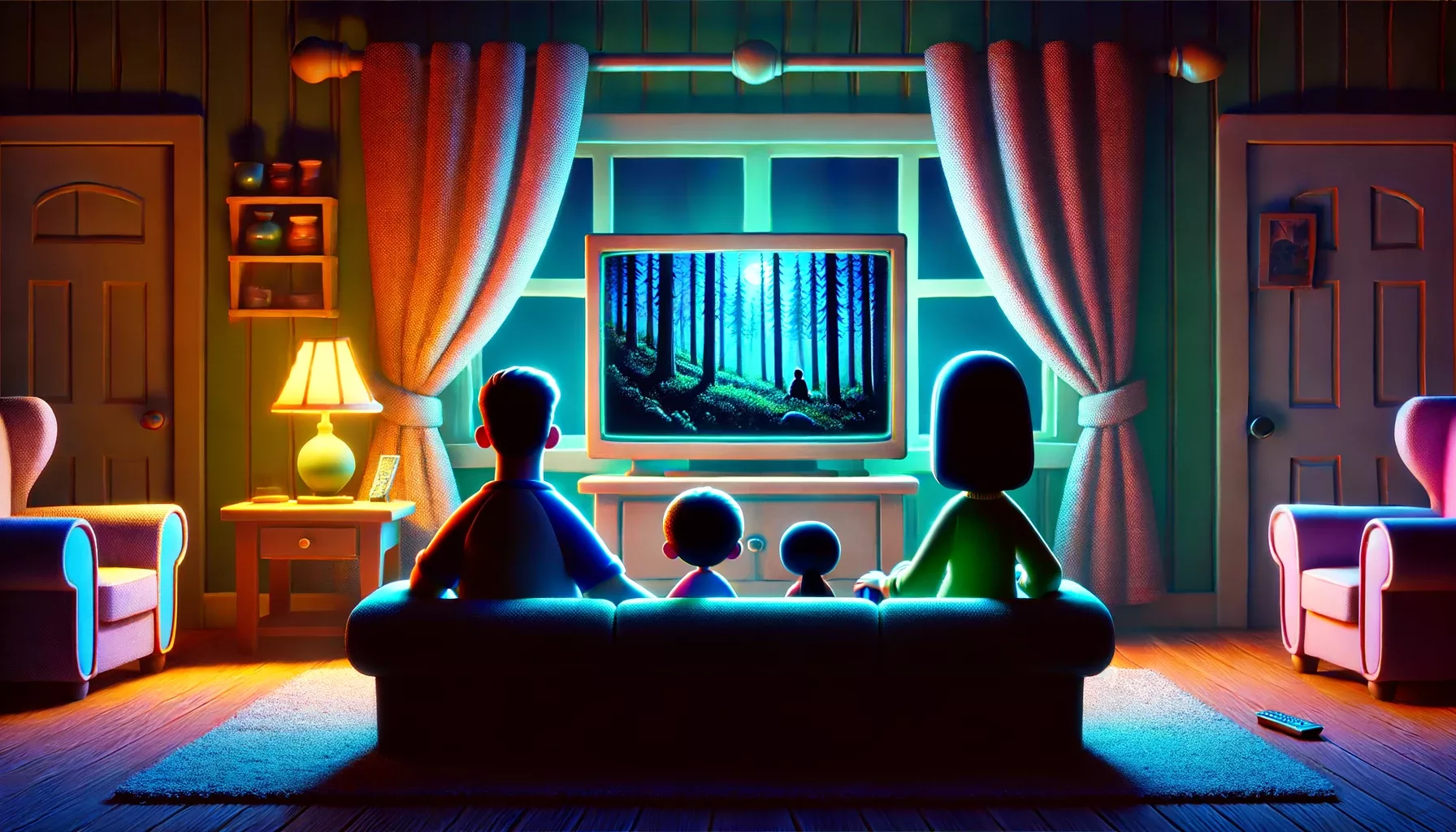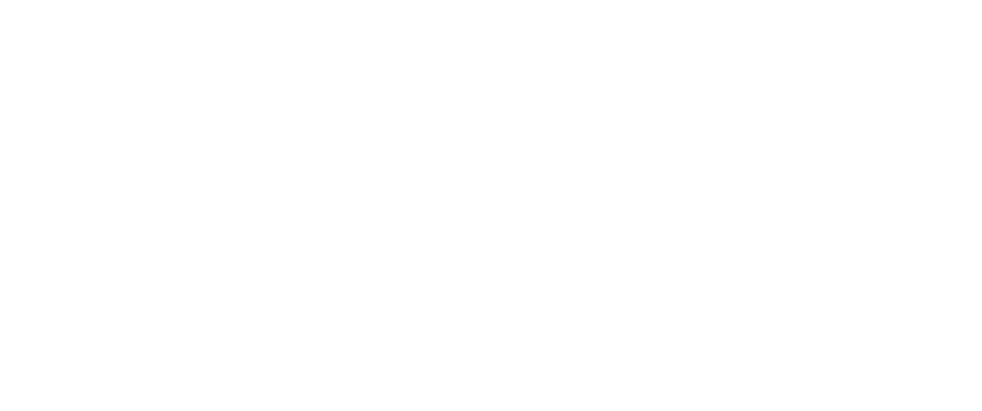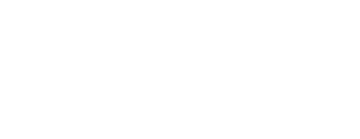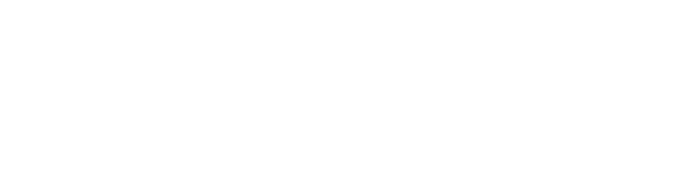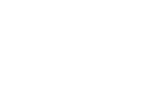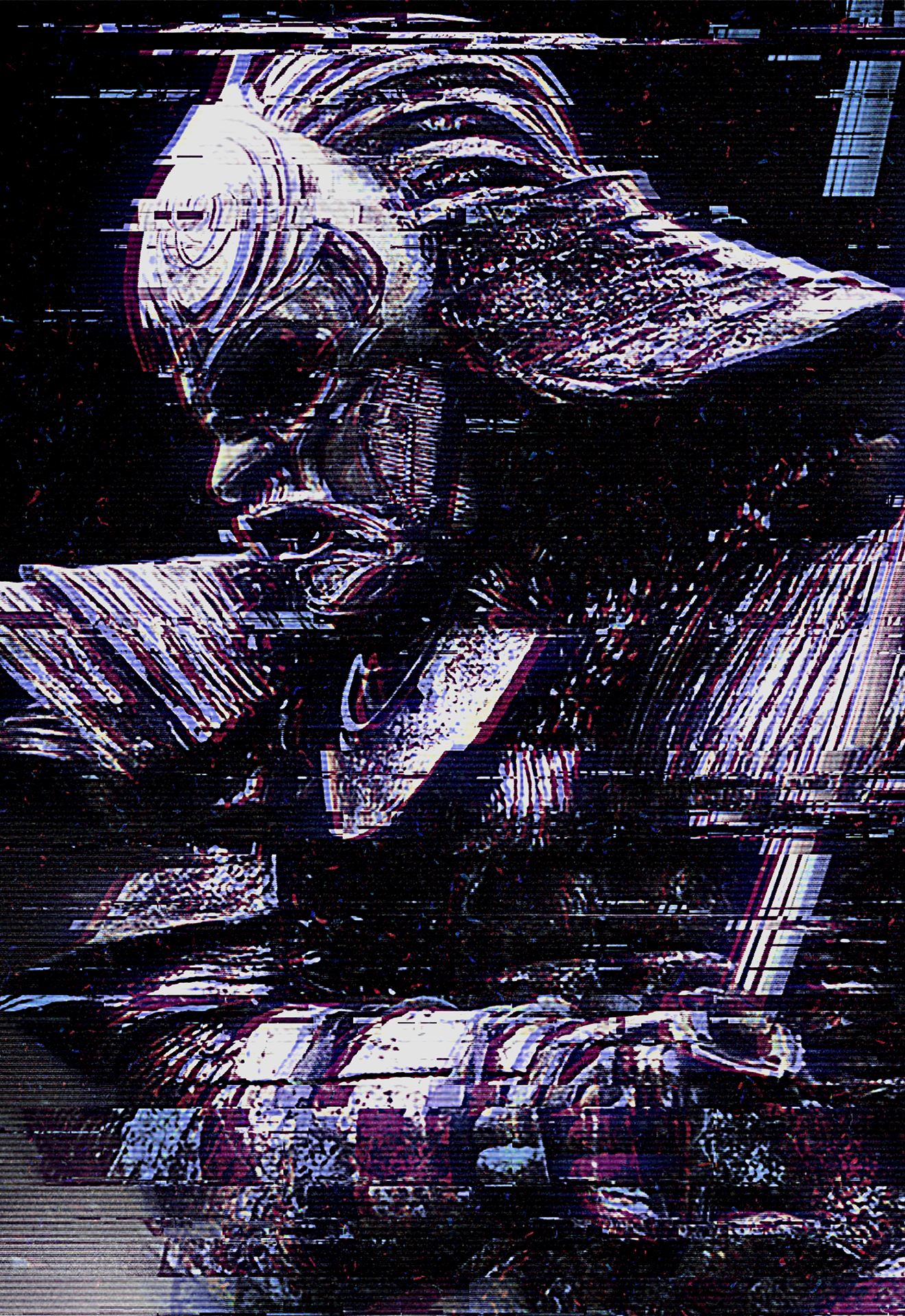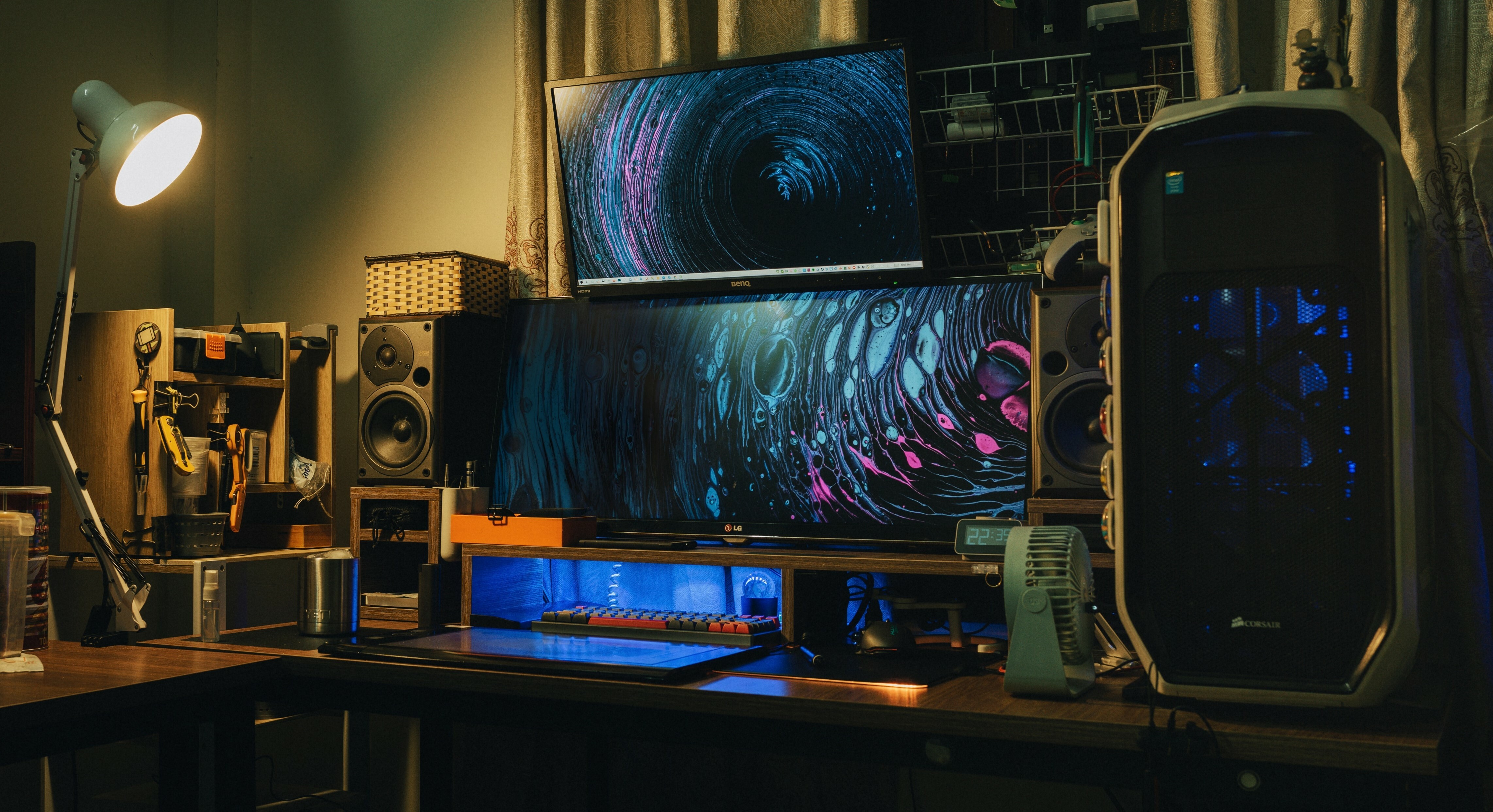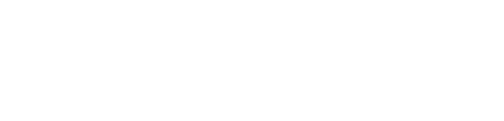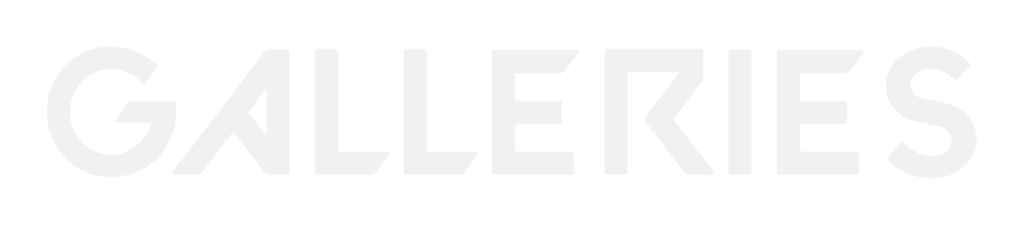Über eine Million Stimmen für den Erhalt digitaler Spielkultur – doch der Verband der europäischen Spielebranche stellt sich quer. Warum eigentlich?

Die Initiative „Stop Killing Games“ trifft einen wunden Punkt der modernen Gaming-Welt: Immer mehr Spiele verschwinden von heute auf morgen, weil Publisher den Support einstellen oder Server abschalten. Was früher als selbstverständlich galt – dass man ein gekauftes Spiel auch in 10 oder 20 Jahren noch spielen kann – wird immer seltener.
Über eine Million Menschen haben deshalb eine Petition unterzeichnet, die Publisher in der EU dazu verpflichten soll, abgeschaltete Spiele weiterhin zugänglich zu machen oder zumindest die Möglichkeit zu schaffen, dass Fans oder Drittanbieter diese weiterbetreiben können. Ins Leben gerufen wurde die Bewegung vom YouTuber Ross Scott, der seit Jahren für den Erhalt digitaler Medien kämpft.
Die Reaktion der Industrie: Blockade statt Dialog
Doch statt konstruktiv nach Lösungen zu suchen, reagiert die europäische Spiele-Lobby mit Abwehr. Der Branchenverband Video Games Europe, der wirtschaftliche Interessen von Publishern in der EU vertritt, hat jetzt ein fünfseitiges Statement veröffentlicht – mit klarer Ablehnung der Forderungen.
Die Kernargumente:
- Ein gesetzlicher Zwang, Server online zu halten, sei wirtschaftlich nicht tragbar.
- Es behindere die Kreativität, wenn Entwickler ihre Spiele so gestalten müssten, dass sie langfristig offline-fähig bleiben.
- Es könnte Sicherheitsrisiken geben, wenn alte Software offen zugänglich bleibt.
Aus Sicht des Verbands ist der Schutz der wirtschaftlichen Interessen der Publisher wichtiger als der langfristige Erhalt der Spiele selbst.
Eine Lobby gegen die Spieler?
Wichtig ist dabei zu verstehen: Video Games Europe ist keine unabhängige Institution, sondern eine klassische Interessenvertretung – ähnlich einem Industrieverband in anderen Branchen. Auch das bekannte Altersfreigabesystem PEGI fällt unter ihre Zuständigkeit. Die Perspektive ist also klar: Der Fokus liegt auf den Herstellern, nicht auf der Community.
Für viele Spieler wirkt die Argumentation wie eine Ausrede: Niemand verlangt, dass jedes Online-Spiel ewig kostenlos betreut wird. Es geht vielmehr darum, Alternativen zu schaffen, anstatt Titel gezielt unspielbar zu machen. Beispiele gibt es genug: „The Crew“ von Ubisoft wurde kürzlich komplett abgeschaltet, obwohl es theoretisch möglich gewesen wäre, den Spielern Offline-Zugang zu ermöglichen. Stattdessen wurden Käufer vor verschlossenen Servern zurückgelassen – obwohl sie einst den vollen Kaufpreis gezahlt haben.
Digitale Produkte – aber kein Eigentum?
Die Debatte weist auf ein grundlegendes Problem der heutigen Spieleindustrie hin: Spieler besitzen moderne Games meist nicht mehr wirklich, sondern kaufen nur eine Lizenz, die jederzeit verfallen kann. Das betrifft nicht nur reine Online-Games, sondern auch Titel mit Always-Online-Zwang oder DRM-Schutz, der später nicht entfernt wird.
Gerade große Publisher könnten hier mit gutem Beispiel vorangehen: Wird ein Spiel nicht mehr aktiv unterstützt, könnte man Server-Codes veröffentlichen oder Fan-Projekte erlauben. Stattdessen drohen oft rechtliche Schritte, wenn Fans versuchen, ein abgeschaltetes Spiel selbst wiederzubeleben.
Ein Schritt in Richtung nachhaltiger Spielkultur
„Stop Killing Games“ fordert genau dies: Wenn der Entwickler keine Ressourcen mehr aufwenden will, sollen andere die Chance bekommen, das Kulturgut zu erhalten. Immerhin sind Spiele längst Teil unseres digitalen Erbes – genauso wie Filme, Bücher oder Musik.
Die Blockadehaltung des Verbands wirkt vor diesem Hintergrund wie ein rückwärtsgewandtes Festhalten an maximaler Kontrolle. Dabei zeigt gerade die Community, dass der Wille zum Erhalt groß ist: Fanserver, Mods und Remaster-Projekte beweisen seit Jahren, wie wichtig alte Titel für Generationen von Spielern sind.
Warum die Initiative wichtig bleibt
Die Entscheidung von Video Games Europe, sich gegen „Stop Killing Games“ zu stellen, wirft ein düsteres Licht auf die Prioritäten der Industrie. Es geht nicht um Nachhaltigkeit oder kulturelles Erbe, sondern um wirtschaftliche Interessen und totale Hoheit über geistiges Eigentum.
Ob das zukunftsfähig ist, darf bezweifelt werden. Immer mehr Spieler stellen sich die Frage: Warum soll ich für ein Vollpreisspiel bezahlen, wenn ich keine Garantie habe, es auch in zehn Jahren noch starten zu können?
Die Initiative hat diese Debatte sichtbar gemacht – und auch wenn der Widerstand groß ist, wächst der Druck auf die Branche. Wer Spiele liebt, möchte sie nicht nur heute genießen, sondern auch morgen. Und genau darum geht es: Stop Killing Games ist mehr als eine Petition. Es ist ein Aufruf, digitale Spielkultur ernst zu nehmen – und sie nicht zugunsten kurzfristiger Profitinteressen einfach abzuschalten.